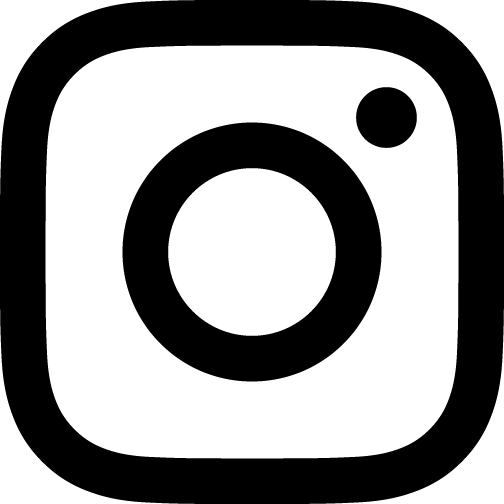Depression
Die Depression gehört zu den sogenannten affektiven Störungen, das sind jene Störungen, die durch Abweichungen in Befindlichkeit und Antrieb gekennzeichnet sind. Affektive Störungen zählen heute (neben Ängsten und Sucht) in den westlichen Industrieländern zu den häufigsten psychischen Erkrankungen. Es scheint, als unterstütze der moderne, hektische Lebensstil diese Entwicklung. Dabei wurden schon sehr früh, bereits in der Antike, affektive Störungen von Hippokrates (4. Jh. v. Chr.) als „Melancholie“ und „Manie“ beschrieben; später, im Mittelalter, galten sie als Strafe Gottes für ein Leben in Sünde. Affektive Störungen kamen bzw. kommen in jeder Gesellschaft vor, sie betreffen jedes Geschlecht und jedes Alter.
Es gab im Laufe der Zeit verschiedene Einteilungen und Klassifizierungen der depressiven Störungen. Seit ca. 15 Jahren erfolgt die Typisierung ausschließlich auf dem Fundament folgender Kategorien:
- Symptomatologie (mono- oder bipolar)
- Schweregrad (leicht-mittel-schwer)
- Krankheitsdauer (einmalig oder wiederkehrend / rezidivierend)
- Rückfallrisiko
Diese Strukturierung erlaubt eine internationale Vergleichbarkeit in den Diagnosekatalogen, wie etwa dem ICD-10 (Internationale Klassifikation psychischer Störungen/Disorders) bzw. dem DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), unabhängig vom immer noch begrenzten Wissen um die Ursachen der Krankheitsentwicklung, der sogenannten Ätiopathogenese affektiver Störungen.
Episoden von Niedergeschlagenheit, von Mut-, Lust- und Antriebslosigkeit, speziell nach Enttäuschungen, Konflikten oder Trennungen gehören zum „ganz normalen“ Leben. Die Stimmungseinengung durch eine Depression kennzeichnet aber eine behandlungswertige Erkrankung. Mag der Übergang fließend, die Trennlinie zwischen normaler und bereits krankhafter Reaktion manchmal schwierig zu ziehen sein: die Intensität und Komplexität der Symptomatik sowie die Dauer der Beeinträchtigung lassen relativ klar erkennen, wann der Status einer Erkrankung erreicht ist. Bei Depressionen deutlich ausgeprägt sind Interessensverlust und erhöhte Ermüdbarkeit. Dazu kommen Symptome wie Niedergeschlagenheit, Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung, ein vermindertes Selbstwertgefühl, fehlendes Selbstvertrauen, Konzentrations- und Merkfähigkeitsstörungen. Ausschließlich pessimistische Zukunftsperspektiven runden dieses Bild ab. Zum Interessensverlust gesellt sich Energielosigkeit, der Alltag ist kaum mehr zu bewältigen, Freudlosigkeit führt zu Vermeidungsverhalten. Sozialer Rückzug und Isolation sind die Folge davon. Das Denkvermögen ist eingeschränkt. Das Fällen von Entscheidungen wird durch Grübelzwang und diverse Ängste verunmöglicht. Ein Gefühl von Gefühllosigkeit lässt Betroffene affektflach („gefühlsverarmt“) und reaktionslos („kühl“) auf äußere Ereignisse erscheinen.
Je nach Dauer und Intensität kann es aufgrund erdrückender (zumeist grundloser) Vorwürfe gegen sich selbst sowie Schuldgefühlen zu Suizidgedanken bzw. Selbstmordversuchen kommen, wobei die Suizidgefährdung speziell im Rahmen einer abklingenden Depression besteht. Auch können durch die seelischen Probleme körperliche Beschwerden entstehen, wie z.B. „bleierne“ Gewichte in den Extremitäten, Verspannungen oder etwa Rückenschmerzen.
Das auffallendste, weil am häufigsten von nahezu allen Betroffenen als besonders belastend empfundene Symptom sind Störungen des Schlafes. Schlafstörungen sind Ausdruck eines gestörten 24-Stunden-Rhythmus. Betroffene leiden unter Ein- und/oder Durchschlafstörungen und frühmorgendlichem Erwachen, das oft in Kombination mit einem depressionsintensivierenden Morgentief auftritt.
Depressive Störungen zeigen einen deutlichen Erkrankungsgipfel im Frühjahr, einen weiteren, weniger markanten Anstieg im Herbst. Eine Rolle könnte hierbei auch das mangelnde Sonnenlicht und der damit verbundene Vitamin-D-Mangel spielen. Weiters sind Frauen häufiger von der Erkrankung betroffen als Männer.
Die Ursachen einer Depression sind vielfältig. Genetische Veranlagungen, Störungen des Stoffwechsels im Gehirn sowie bestimmte Ausprägungen der eigenen Persönlichkeit haben Anteil daran, dass Betroffene über eine geringere Schutzbarriere gegenüber seelischen bzw. körperlichen Belastungsfaktoren verfügen und dadurch das Auftreten einer Depression ermöglicht wird.
Familiäre Vorbelastung
Studienergebnisse zeigen, dass Depressionen familiär gehäuft auftreten. Leidet beispielsweise ein Verwandter 1. Grades an einer Depression, so liegt die Wahrscheinlichkeit, selbst an einer Depression zu erkranken bei 15%. Diese Ergebnisse liefern einen deutlichen Hinweis auf das Vorliegen genetischer Faktoren.
Neurobiologische Faktoren
Serotonin wird häufig landläufig als das „Glückshormon“ bezeichnet. Tatsächlich gibt es viele Untersuchungen, die darauf hindeuten, dass bestimmte Botenstoffe, darunter das Serotonin, aus dem Gleichgewicht geraten sind.
Chronische Stressbelastung führt zur vermehrten Ausschüttung des Stresshormons Cortisol, das wiederum als Risikofaktor für das Auftreten einer Depression genannt werden kann.
Man konnte weiters mit Hilfe von bildgebenden Verfahren nachweisen, dass depressive Personen eine ausgeprägte Aktivität jener Hirnregion zeigen, die verantwortlich für die Stressregulierung und die Verarbeitung von Gefühlen ist. Daraus kann die besondere Vulnerabilität (Verletzlichkeit) der Betroffenen abgeleitet werden, die durch eine höhere Empfindlichkeit gegenüber belastenden äußeren Einflüssen erkennbar ist.
Psychosoziale Faktoren
Wir alle werden durch unser soziales Umfeld geprägt. Bestimmte (negative) Erfahrungen fördern im Zusammenspiel mit anderen Faktoren die Entstehung von depressiven Episoden. Beispiele von typischen Erlebnissen sind ein überbehütendes Elternhaus ebenso wie der Verlust von nahestehenden Personen oder andere traumatische Ereignisse.
Darüber hinaus begünstigen gewisse Charaktereigenschaften, beispielsweise Selbstunsicherheit, ausgeprägte Leistungsorientierung, Perfektionismus, aber auch ein Defizit in der Abgrenzung zu anderen das Entstehen von Depressionen.
Weitere Risikofaktoren sind Medikamenten-, Drogen- bzw. Alkoholmissbrauch sowie belastende Lebensumstände, wie etwa Arbeitslosigkeit oder eine bestehende körperliche Erkrankung.
Behandlung auf Basis eines Bio-Psycho-Sozialen Mehr-Säulen-Modells:
Da die Ursachen einer affektiven Störung immer “multifaktoriell”, also biologisch, genetisch, entwicklungsgeschichtlich, psychosozial, kommunikations- bzw. interaktionsbedingt und von verschiedenen „Life Events“ abhängig sind, sollte der Behandlungsansatz ebenfalls systemisch sein. Konkret bedeutet dies die Einbeziehung der individuellen Situation, der Tagesstruktur und des sozialen Netzwerkes in die Therapie, die durch Gespräche, Beschäftigung, Bewegung, medikamentös und vieles andere mehr erfolgt.
Drei Stadien lassen sich in der Behandlung unterscheiden:
- Akutbehandlung (vorwiegend medikamentös)
- Erhaltungstherapie (um nach Abklingen der akuten Störung einen Rückfall zu vermeiden)
- Prophylaktische Therapie (um einer Wiedererkrankung vorzubeugen)
Die medikamentöse Therapie sollte stets fachärztlich verordnet und von einer psychologischen bzw. psychotherapeutischen Arbeit begleitet werden, um einen nachhaltigen Behandlungserfolg zu erzielen. Heutzutage werden meistens Antidepressiva eingesetzt, die gezielt das Gleichgewicht der Botenstoffe im Gehirn wiederherstellen sollen. Zu dieser Gruppe der Antidepressiva gehören beispielsweise die Serotonin-, Noradrenalin- oder/und Dopamin-Wiederaufnahme-Hemmer. Sie setzen bei der Wirksamkeit der körpereigenen Botenstoffe an, werden im Allgemeinen gut vertragen und erzeugen keine Abhängigkeit. Die sogenannten trizyklischen Antidepressiva gehören zu einer älteren Medikamentenklasse, die ein breiteres Wirkungsspektrum haben, aber aufgrund ihrer Nebenwirkungen nicht mehr so häufig zum Einsatz kommen. Bei bestimmten Formen der Depression kommen neben den genannten Medikamenten auch andere Psychopharmaka zum Einsatz.
In der Erhaltungstherapie gewinnen neben den medikamentösen Methoden andere therapeutische Optionen an Bedeutung. Psychologische und/oder psychotherapeutische Methoden sind sowohl im Einzel- wie im Gruppensetting empfehlenswert. Besonders wirksam sind Ansätze, die sich mit der Klärung der Auslöser der Erkrankung sowie der Förderung von eigenen Kraftquellen (Ressourcenaktivierung) auseinandersetzen.
Weitere unterstützende Methoden sind beispielsweise Biofeedback oder Lichttherapie (das ist der Konsum von tgl. ½ Stunde 10.000 Lux hellem Licht bei saisonalen Depressionen). Auch Bewegung und Sport haben eine positive Auswirkung auf die persönliche Stimmung und Befindlichkeit.
Lesetipps:
- "Selbsthilfe bei Depressionen" Görlitz, G.; Vlerl. Klett-Cotta, Stuttgart 2010
- "Depressionen verstehen und bewältigen" Wolfersdorf, M.; Springer-Verl, Berlin, Heidelberg, 2011
- "Depressionen überwinden" ein Ratgeber für Betroffene & Angehörige; Stiftung Warentest Berlin 1998
- "Ratgeber Trauer - Informationen für Betroffene und Angehörige" Znoj, H.; Reihe "Fortschritte der Psychotherapie"; Hogrefe-Verlag; Göttingen-Bern-Toronto; 2005
- "Ratgeber Chronische Depression - Informationen für Betroffene und Angehörige" Wolkenstein, L; Hautzinger, M.; Reihe "Fortschritte der Psychotherapie"; Hogrefe-Verlag; Göttingen-Bern-Toronto; 2015
- "Ratgeber Depression - Informationen für Betroffene und Angehörige" Hautzinger, M.; Reihe "Fortschritte der Psychotherapie"; Hogrefe-Verlag; Göttingen-Bern-Toronto; 2006
- "Suizidgefahr? - Ein Ratgeber für Betroffene und Angehörige" Teismann, T.; Dorrmann, W.: Reihe "Fortschritte der Psychotherapie"; Hogrefe-Verlag; Göttingen-Bern-Toronto; 2015
Bündnis gegen Depression: Anlaufstellen in Österreich und Information für Betroffene und Angehörige
Redaktion:
Mag. Elisabeth Distlberger, Dr. Andrea Jansche, Prim. Dr. Ingeburg Spendel, Mag. Petra Müller